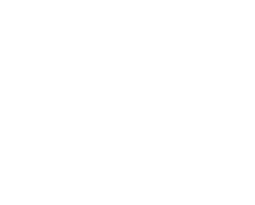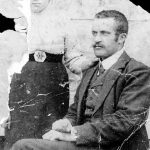Geschichte • Teil 5
Die fremde Heimat
von Maria Patzer
Fast ein Jahrhundert (1763–1862) lang wanderten Deutsche aus Hessen, Pfalz, Rheinland, Württemberg, Schweiz, Preußen, Ungarn, Baden in das große russische Reich. Bis Ende des 19. Jh. existierten in Rußland über 2.000 deutsche Siedlungen. Die größte Zahl der Siedlungen waren Dörfer, in denen die Deutschen mehrere Jahrzehnte lebten. Hier hielten sie ihre Kultur, konfessionelle Zugehörigkeit, Sitten und Gebräuchen aufrecht. In den Städten war dies nicht möglich.
Viele stammten aus Hessen, aus den Kreisen und Gemeinden Friedberg, Gelnhausen, Hanau, Isenburg, Nidda, Odenwald, Wetterau, Wächtersbach usw. Sie siedelten an die Wolga nach Saratow in die Kolonien – Balzer, Beerenfeld (russ. Jagodnaja Poljana), Norka, Schilling (Sosnowka), und andere Ortschaften. Es waren die Familien: Appel, Daubert, Block, Luft, Görlitz, Gorr, Rohn, Ruhl, Becker, Bär, Koch, Schuchart, Weitz, Scheuermann und Kaiser aus Nidda; Blumenschein, Holstein und Lautenschläger aus Erbach; Dippel, Kromm, Repp aus Schotten; Morasch aus Brunnberg; Rausch aus Ulrichstein; Stapper aus Hanau; Litzenberg und Leinweber aus Offenbach; Schneidmüller, Merkel und Stuckart aus Babenhausen; Benner aus Limberg; Jungmann, Stang, Assmus aus Wallernhausen und andere.
Die Familien verteilten sich auf Kolonien und bauten ihre Häuser. Bis 1871 spürte man in den Kolonien eine große Aufwärtsentwicklung. Aufstieg und Ausbreitung der Deutschen wurde von dem russischen Volk als Machtfaktor angesehen. Die Selbstverwaltung unterstand ab 4. Juni 1871 dem russischen Innenministerium. Gemeindebücher mussten in der Amtssprache Russisch geführt werden. In allen Fächern, mit Ausnahme von Religion und Deutsch, wurde in den Schulen Russisch unterrichtet. Damit wurde das Kolonistengesetz aufgehoben. Die heranwachsende Jugend wurde zum Militärdienst eingezogen. Die Befreiung vom Militär auf ewige Zeiten aus dem Manifest von Katharina II. galt nicht mehr. Diese Änderungen lösten unter den Kolonisten Unmut und Unsicherheit aus. In den Jahren 1876 bis 1913 wanderten über 100.000 Deutsche nach Brasilien, USA, Südamerika, Nord Dakota und zurück nach Deutschland aus. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges verschärfte sich die Russifizierungspolitik. Die Rußlanddeutschen wurden zum "inneren Feind" erklärt. Durch die Enteignungsgesetze 1915 sollten allen Deutschen der Grund und Boden enteignet werden. Sie selbst sollten ausgesiedelt und nach Sibirien verbannt werden.
Familie Pfaffenroth aus Jagodnaja Poljana:
Der ausgewanderte Andreas Pfaffenroth wurde am 2. Dezember 1732 als zweites von acht Kindern geborene Adam, Sohn von Caspar Pfaffenroth und Anna geb. Dieffenbach, Enkel von Johann Ludwig und Urenkel des Lehrers Franz Pfaffenroth. Er entschloss sich 1766 mit seiner Frau Anna Elisabeth und den Kindern Johann Konrad, Katharina und Anna Maria auszuwandern. Er und andere Familien so auch die Familien Daubert, Luft, Scheuermann, Blumenschein, Lautenschläger, Morasch, Benner/Penner und weitere siedelten am 16. September 1767 in die Wolga-Kolonie Jagodnaja Poljana um. Hier bauten sie ihren kleinen Besitz mit 15 Rubel, 2 Pferden und 1 Kuh auf.
Schon nach mehreren Jahren konnten sich der Nachkomme des Andreas Pfaffenroth – Philipp eine Getreidemühle leisten. Seine Söhne Adam, Johann, Andreas und der jüngste Philipp bauten die Mühle sorgfältig auf. Adam nahm Bestellungen an und kaufte in anderen Dörfern Weizen, Roggen und Gerste ein. Gemeinsam verarbeiteten Geschwister das Getreide zu Mehl. Zuerst wurde das Getreide gereinigt, dann mit Walzenstühlen vermahlen. Anschließend siebten die Brüder das Mahlgut in einen Behälter (Mehlkasten). Der Schrot wurde wieder und wieder vermahlen, bis das ganze Mehl herausgelöst war. Das fertige Mehl wurde in die abgestempelten Säcke mit dem Audruck „Brüder Pfaffenroth“ geschüttet und anschließend von Johann auf dem Basar zum Verkauf gebracht. Der Bauernhof wurde immer größer und nach wenigen Generationen gehörte die Familie zu den Großbauern mit einem ansehnlichen Besitz.

Familie Pfaffenroth in Jagodnaja Poljana 1908, zweiter v. l. Andreas Pfaffenroth mit Ehefrau Maria geb. Pfaffenroth ihre Kinder Wilhelm 2 Jahre und Olga 1 Jahr alt.
Foto: Privatarchiv Familie Pfaffenroth
Nach der Revolution von 1917 bis 1939 wurden die, die einen großen Grundbesitz hatten, als Kulaken bezeichnet. Der Begriff Kulak war eine Bezeichnung für Händler, Mittel- und Großbauern. So wurden Russifizierungsmaßnahmen veranlasst, um den Neid gegen diese Gruppe zu stoppen. Der erste Weltkrieg verstärkte den Druck auf die Deutschen, die als Feinde des Staates angesehen wurden. Das Eigentum wurde enteignet, es folgten die ersten Deportationen nach Sibirien. 1928–1932 wurde von Stalin die Zwangskollektivierung der Bauern angefangen. Tausende von ihnen wurden verbannt oder getötet. Die Deutschen traf es besonders hart, weil ihre Dörfer zu dieser Zeit viel besser entwickelt und fortgeschritten waren, als andere Gebiete Rußlands. Das Vieh, Pferde, Sämaschine, Mühle, Lebensmittel und vieles andere aus seinem Besitz mussten an die Kolchose abgegeben werden.
Viele Dorfbewohner wanderten nach Amerika aus, oder gingen nach Deutschland zurück. So wie viele andere im Dorf wurde auch die Familie Pfaffenroth enteignet. Die Mühle wurde von den "Sowjets" privatisiert und nach kurzer Zeit in Teilen verschleppt. Immer wieder kamen die "Sowjets", um Lebensmittel zu holen, bis die Familien nichts mehr hatten. Wer die Abgabe von Lebensmitteln nicht erfüllte, wurde verhaftet und nach Sibirien deportiert.
Der Vater von Andreas Pfaffenroth (Johann Pfaffenroth) verstarb, als Andreas noch ein Kind war. Er wuchs bei Verwandten auf, heiratete später seine Kusine Maria, geb. Pfaffenroth (1882–1953). Sie zogen zwei Kinder, Wilhelm und Olga, auf. Er pflegte in Jagodnaja Poljana den Obstgarten und hatte den Spitzname Blumenschein. Spitznamen hatten viele Familien im Dorf. Sie entstanden um die Familien, die den gleichen Namen hatten, unterscheiden zu können.
Andreas (1880–1917) war von Kind an behindert und verstarb im Alter von nur 37 Jahren. Am Tag der Enteignung bekam Wilhelm – Sohn des Andreas – vom Besitz des Vaters nur eine Uhr, die dieser sein ganzes Leben lang bei sich getragen hatte. 1934 zog Wilhelm ins Dorf Schilling (Sosnowka) um. Von hier wurden seine Familie, Verwandte und alle Dorfbewohner am 16. September 1941 nach Sibirien deportiert.
Die Frau von Wilhelm, Maria (geb. Weigand) war noch im Krankenhaus, denn der Sohn Sascha war vor zwei Tagen erst geboren worden. Trotzdem mussten sie packen. Es durfte nur das Wichtigste mitgenommen werden. Zurück blieben das Haus samt Inventar und allen Haustieren. Auf dem Weg zum Bahnhof holte er seine Frau aus dem Krankenhaus ab. Am Bahnhof hatten sie mit acht Kindern Nina, Alvina, Friedrich, Viktor, Katharina, Olga, Wilhelm und Alexander auf den Zug warten müssen. Sie wurden in die Viehwaggons des Zuges Nr. 738 geladen, in denen lediglich ein Strohhaufen lag. In jeden Waggon wurden über 40 Personen gepfercht, dann wurden die Waggons verriegelt – und ab ging es in eine ungewisse Zukunft. Der Säugling Sascha weinte ständig, die Muttermilch reichte nicht und es war kalt. Die Windeln trockneten langsam. Um die Windel trocken und warm zu kriegen, wickelte die Maria die Windeln um den eigenen Körper.
Am 26. September kamen sie in Kolomsino (heute Karbyschewo) bei Omsk an. Von hier wurden sie in einen anderen Zug verfrachtet und nach Kucharewo bei Moskalenki/Omsk transportiert. Da warteten schon auf sie die Lastwagen. Sie und andere Familien – Luft, Scheuermann, Jungmann u.a. wurden auf die Lkws geladen und nach Swesdino gebracht. Und da wurden sie nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Sie waren ja alle ungeladene Gäste. Sie waren die Deutschen und für das Russische Dorf „die Faschisten“. Hier wurden sie in einem Viehstall einquartiert. Der Viehgeruch war noch zu bemerken. Jede Familie wurde auf die einzelnen Kuh-Stellen verteilt. Sie durften auf den dreckigen Boden Stroh legen und sich nach der langen Fahrt ausruhen. Die Kinder weinten. Die Erwachsenen versuchten sie zu beruhigen. Nach und nach wurde es im Stall immer stiller… So versuchten sie weiter zu leben. Etwas verlangen, bitten, sich erniedrigen – war nicht ihre Art.
Wilhelms Mutter Maria Pfaffenroth und seine Schwester Olga (verh. Luft) wurden von ihnen getrennt und nach Nowosibirsk des Kreises Ojasch evakuiert. Alle 2.155 Wolgadeutschen, die mit dem Zugtransport Nr. 738 ankamen, wurden über ganz Sibirien zerstreut. Die Familien wurden auseinandergerissen und auf Jahre hinaus von den Verwandten getrennt und in unbekannten Gebieten abgesetzt. Noch heute suchen sie im ganzen Land ihre Geschwister, Väter und Mütter, im Land in dem man sich immer "fremder" fühlte.
Die Frauen und Männer im Alter von 15 bis 60 Jahren wurden ab 1942 in die Zwangsarbeit eingezogen – in bewachte Zwangsarbeitslager mit Stacheldraht, häufig im hohen Norden und in unwirtschaftlichen Gebieten des Landes. Unter härtesten Bedingungen mussten sie im Bergbau, in der Holz- und Rüstungsindustrie arbeiten.
Am 25. Januar 1942 wurde Wilhelm Pfaffenroth in die Trudarmee eingezogen. Die Frau blieb mit acht Kindern. Die beiden ältesten Kinder – Nina wurde als Traktorfahrerin angelernt, Alvina musste sich um die Schafe kümmern. Später wurden auch sie eingezogen. Der Friedrich, als 12-jähriger Junge, war zu Hause mit den Kleinen. Die Mutter arbeitete in der Nähstube, wo sie für die Armee Sachen stricken und nähen musste. Essen bekamen die Familien aus der Kolchos-Kantine. Aber es reichte nicht aus. Ständig musste noch zusätzlich gebettelt werden. Auch Sascha, der Jüngste, hatte dauernd Hunger. Als Lutscher hatte Friedrich gekautes Brot in Stoff eingewickelt und ihm zu lutschen gegeben. Das war alles, was er am Tag manchmal bekommen hatte.
Kurz nach Vaters Einzug in die Trudarmee, bekam auch die Mutter eine Einladung. Sie musste zur Vorstellung in das Kreissowjets (Kreisverwaltung). An diesem Tag war es schrecklich kalt. Frühmorgens kam der Predsedatel, er sollte sie mit dem kleinen Kind nach Moskalenki fahren. Der kleine Sascha hatte keine warmen Sachen. Sie wickelte ihn in alle Lumpen, die sie hatte und zog noch ihre eigene warme Strickhose obendrauf. Sie legte in die Rocktasche den Brotlutscher ein. Ständig putzte sie sich mit der Schürze die Träne ab. Und zum Abschied bekam jedes Kind einen Kuss. Sie setzte sich auf den kalten Schlitten, deckte die nackten Beine mit einem Kartoffelsack ab und steckte Sascha unter die eigene Jacke. Der Predsedatel fuhr schnell los. Sie hatten einen langen Weg von ca. 20 km vor sich. Olga und Willi hörten nicht auf zu weinen. Friedrich führte sie in die Semljanka. Er hatte Angst, dass sie die Mutter, nie wiedersehen werden. Den kleinen Sascha hörte man noch lange weinen. Erst am späten Abend kam sie nach Hause. Da der Sascha noch keine drei Jahre alt war, wurde Maria Pfaffenroth in die Trudarmee nicht eingezogen.
Noch nach dem Krieg lebten die Deutschen in Rußland ohne Wohnungen, Lebensmittel, Strom oder Heizmaterial und hausten Jahre lang in Erdhöhlen. Viele erfroren, verhungerten oder starben an Krankheiten. Sie wurden unter Kommandatur bis Ende 1956 gestellt (s. Ausweis v. Katharina Pfaffenroth), d.h. sie mussten sich in kürzeren Abständen bei den Behörden melden, sie durften ihren Wohnort – falls man von „Wohnen“ sprechen kann – nicht verlassen, waren ohne Bürgerrechte und wurden in jeder Hinsicht benachteiligt. Sie waren keine Menschen mehr, sondern „Deutsche“ sprich: „Faschisten“.
Erst nach dem Besuch des deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer vom 9.–13. September 1955 in Moskau folgte das Dekret "Über die Aufhebung der Beschränkungen in der Rechtsstellung der Deutschen und ihrer Familienangehörigen, die sich in Sondersiedlungen befanden". Aber es gab keine Rückgabe des bei der Verbannung konfiszierten Vermögens und keine Aufhebung des Verbots der Rückkehr in die ehemaligen Heimatkolonien. Im Jahre 1964 folgte der Erlass über die Rehabilitierung der Deutschen und die Aufhebung des Deportationsdekrets vom 28. August 1941.
Über 50 Jahre lebte die Familie Pfaffenroth in Sibirien. Hier in Deutschland haben die Enkelkinder von Andreas Pfaffenroth – Friedrich, Katharina (verh. Buchmüller, 1935–2004), Wilhelm, Olga (verh. Winter), Alexander, Boris und Galina (verh. Buchmüller) ein neues Leben angefangen. Das Leben geht weiter, die Nachkommen schlagen Wurzeln, sie haben die Schwierigkeiten überlebt. Hier versuchen sie, eine neue Heimat zu finden, neue Freundschaften zu schließen und die Anerkennung zu finden, sich ganz einfach wohl zu fühlen – das braucht Zeit.