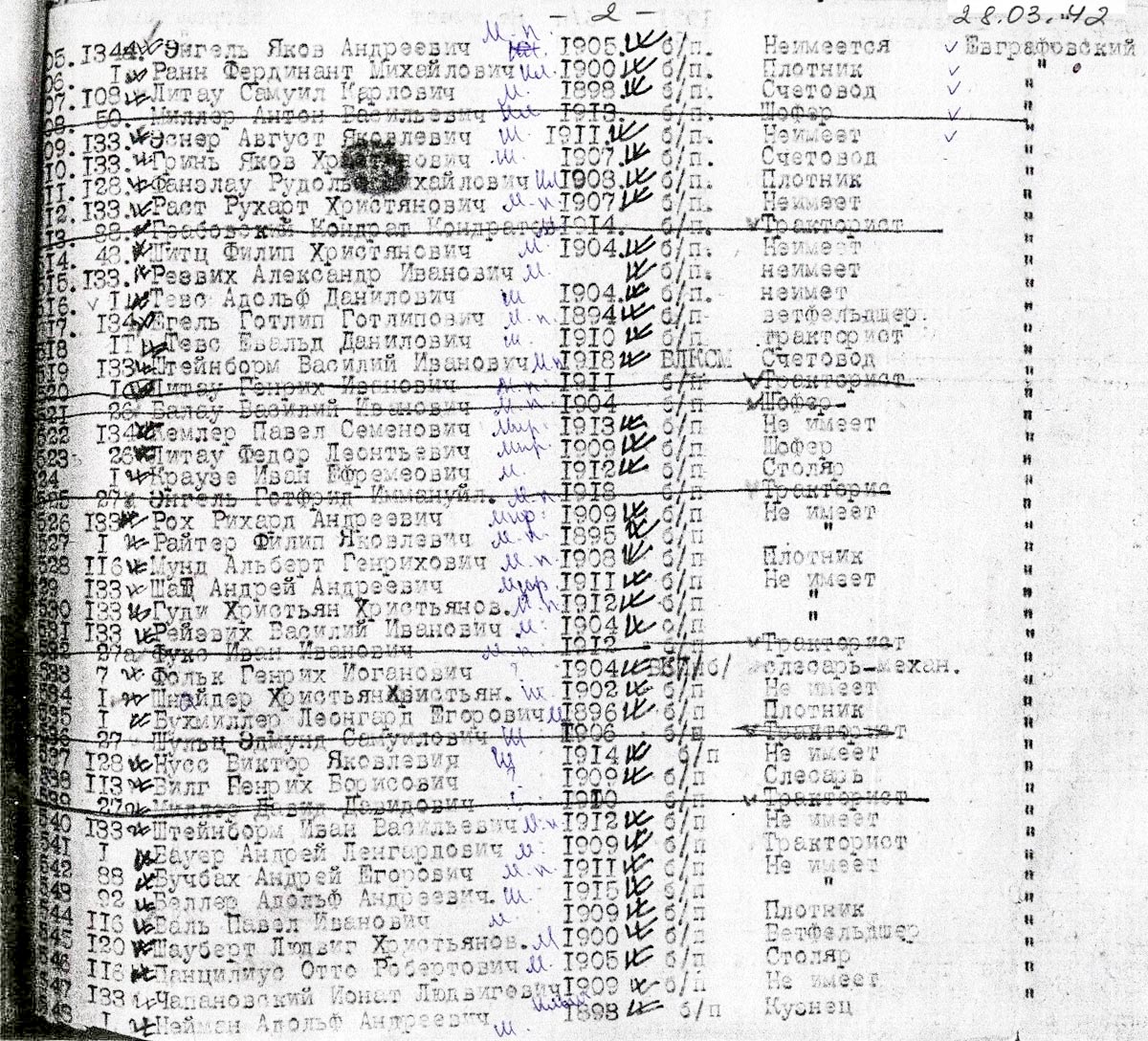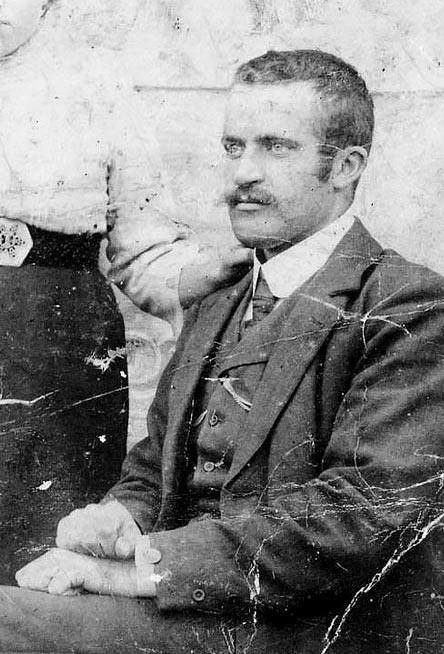Geschichte • Teil 1
Vorgeschichte
von Jakob Schütz
Und er (Gott) hat gemacht, daß... aller Menschen Geschlechter auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat Ziel gesetzt und vorgesehen, wie lange und wie weit sie wohnen sollen;
Apg I7, 26.
Die Geschichte des Dorfes Mironowka hat viele Jahre früher begonnen – vor der Gründung des Dorfes. Der weise GOTT hatte unsere Vorfahren dazu bewogen aus Deutschland auszuwandern und die noch schwach bevölkerten Gebiete Südrußlands zu besiedeln. Die ersten Neusiedlungen entstanden 1789 im Gebiet Saporoshje, in der Ukraine. Dem folgten weitere Siedlungen. Doch sehr bald wurde nach neuen Ländereien Ausschau gehalten, und so kam es, daß auch in ferner Sibirien Land gekauft wurde. In den Jahren 1897 – 1900 siedelten im Gebiet Omsk die ersten Bauern aus der Mutterkolonien an. Wie unser Dorf entstanden ist werden wir aus dem geschichtlichen Bericht erfahren.